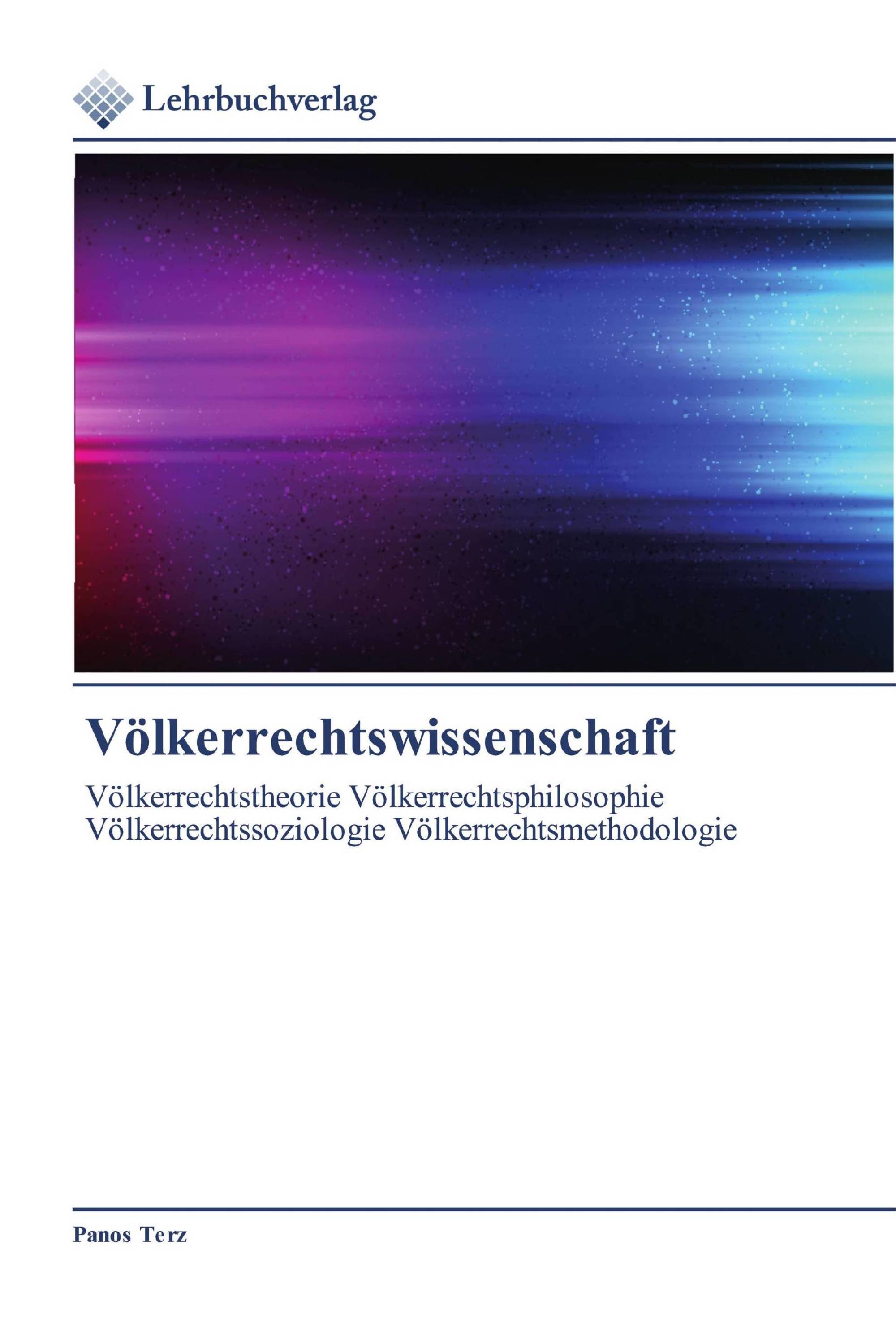Völkerrechtswissenschaft
Völkerrechtstheorie Völkerrechtsphilosophie Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie
Saarbrücken 2019
Die vorliegende Monographie ist das Ergebnis einer fast vierzigjährigen Grundlagenforschung mit Erkenntniszuwachs. Sie soll zur Weiterentwicklung der Völkerrechtswissenschaft beitragen. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Völkerrechtswissenschaft an sich mit ihren Bestandteilen und Wissenschaftsgebieten in statu nascendi (Völkerrechtstheorie, Völkerrechtsphilosophie, Völkerrechtssoziologie und Völkerrechtsmethodologie) und nicht das positive Völkerrecht oder die Zusammenfassung der Werke einzelner Völkerrechtler oder etwa die Vielzahl von verschiedenen Völkerrechtsauffassungen. Darüber gibt es international bereits ganze Bibliotheken. Eine interessante Besonderheit des Buches besteht darin, dass Fachliteratur aus allen Kultur- und Rechtskreisen und in mehreren Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Griechisch, Bulgarisch, Arabisch, Altgriechisch und Latein) ausgewertet worden ist. Dies war möglich, weil der Autor als Hochschullehrer jahrelang Studenten und Doktoranden aus siebzig Ländern ausgebildet hat.
Buch Details: |
|
| ISBN-13: | 978-620-0-27090-0 |
| ISBN-10: | 6200270902 |
| EAN: | 9786200270900 |
| Buchsprache: | Deutsch |
| von (Autor): | Panos Terz |
| Seitenanzahl: | 260 |
| Veröffentlicht am: | 20.09.2019 |
| Kategorie: | Internationales Recht, Ausländisches Recht |
Panos Terz
Dimensionen der Völkerrechtswissenschaft
Völkerrechtstheorie, Völkerrechtsphilosophie,
Völkerrechtssoziologie, Völkerrechtsmethodologie
Eine transdisziplinäre Untersuchung
In honorem patrum hispanorum Scientiae Iuris inter Gentes
Francisco de Vitoria et Francisco Suárez
INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG …………………………………………………………………………………. 9
1. Völkerrechtstheorie als Bestandteil der Völkerrechtswissenschaft
und als Wissenschaftsgebiet in statu nascendi ……………………………. 15
1.1 Philosophie und Allgemeine Rechtstheorie als Grundlage der
Völkerrechtstheorie ………………………………………………………………… 15
1.2 Rechtscharakter und Hauptfunktionen des Völkerrechts als
Gegenstand der Völkerrechtstheorie …………………………………………. 20
1.3 System des Völkerrechts und der Völkerrechtswissenschaft
als Gegenstand der Völkerrechtstheorie ……………………………………. 29
1.4 Struktur des Völkerrechts und der Völkerrechtswissenschaft
als Gegenstand der Völkerrechtstheorie ……………………………………. 34
1.5 Zweige des Völkerrechts als Gegenstand der Völkerrechtstheorie 38
1.6 Die Institute des Völkerrechts als Gegenstand der
Völkerrechtstheorie ………………………………………………………………… 40
1.7 Völkerrechtsnormen als Gegenstand der Völkerrechtstheorie ……… 42
1.7.1 Charakter und Merkmale der Völkerrechtsnormen …………………….. 42
1.7.2 Struktur der Völkerrechtsnormen …………………………………………….. 43
1.7.3 Bedeutung der Völkerrechtsnormen …………………………………………. 45
1.7.4 Verhältnis von Prinzip und Norm im Völkerrecht ………………………. 45
1.7.5 Hierarchie der Völkerrechtsnormen ………………………………………….. 47
1.8 Schlussfolgerungen ………………………………………………………………… 49
1.9 Anmerkungen ………………………………………………………………………… 51
2. Völkerrechtsphilosophie als Bestandteil der Völkerrechtswissenschaft
und als Wissenschaftsgebiet in statu nascendi ………………….. 62
2.1 Philosophie und Rechtsphilosophie als Grundlage der
Völkerrechtsphilosophie …………………………………………………………. 62
2.2 Hauptkategorien, Gegenstand und Hauptaufgaben der
Völkerrechtsphilosophie …………………………………………………………. 66
2.3 Werte als Gegenstand der Völkerrechtsphilosophie ……………………. 68
2.4 Moralnormen als Gegenstand der Völkerrechtsphilosophie …………. 69
2.5 Schlussfolgerungen ………………………………………………………………… 74
2.6 Anmerkungen ………………………………………………………………………… 76
5
3. Völkerrechtssoziologie als Bestandteil der Völkerrechtswissenschaft
und als Wissenschaftsgebiet in statu nascendi ……………………………. 80
3.1 Soziologie und Rechtssoziologie als Grundlage der
Völkerrechtssoziologie ……………………………………………………………. 80
3.2 Wesen der Völkerrechtssoziologie …………………………………………… 81
3.3 Bestandteile der Völkerrechtssoziologie ……………………………………. 83
3.4 Hauptkategorien, Gegenstand und Aufgaben der
Völkerrechtssoziologie ……………………………………………………………. 84
3.5 Verhältnis zwischen der Völkerrechtssoziologie und der
Wissenschaft von den Internationalen Beziehungen …………………… 86
3.5.1 Wissenschaft von den Internationalen Beziehungen
(knapper Überblick) ……………………………………………………………….. 86
3.5.2 Verhältnis zwischen der Völkerrechtswissenschaft, speziell
der Völkerrechtssoziologie und der Wissenschaft von den
Internationalen Beziehungen ……………………………………………………. 88
3.6 Politische Normen als Gegenstand der Völkerrechtssoziologie……. 92
3.6.1 Normbildungstheoretische Aspekte der politischen Normen ……….. 92
3.6.2 Merkmale, Funktion, System und Strukturfragen der politischen
Normen …………………………………………………………………………………. 95
3.6.3 Durchsetzung der politischen Normen………………………………………. 99
3.7 Interessen der Staaten als Hauptkategorie und Gegenstand
der Völkerrechtssoziologie ……………………………………………………. 102
3.7.1 Allgemeine Bedeutung der Interessenproblematik ……………………. 102
3.7.2 Die Methodologie der Interessentheorie ………………………………….. 103
3.7.3 Linguistische (etymologisch-semantische) Aspekte des
Interessenbegriffes ……………………………………………………………….. 105
3.7.4 Philosophische und epistemische Explikationen der
Interessenproblematik …………………………………………………………… 106
3.7.5 Interessenarten als Hauptkategorie und Gegenstand der
Völkerrechtssoziologie ………………………………………………………….. 118
3.7.5.1 Parallele Interessen …………………………………………………………….. 125
3.7.5.2 Gemeinsame Interessen ………………………………………………………. 126
3.7.5.3 Konkurrierende Interessen ………………………………………………….. 127
3.7.5.4 Konträre (antagonistische) Interessen …………………………………… 128
6
3.7.6 Interesse als Gegenstand der Völkerrechtstheorie, speziell der
Normbildungstheorie ……………………………………………………………. 129
3.8 Gleichgewicht als Hauptkategorie und Gegenstand der
Völkerrechtssoziologie ………………………………………………………….. 134
3.8.1 Allgemeine Bedeutung des Gleichgewichts …………………………….. 134
3.8.2 Methodologie der Gleichgewichtstheorie ………………………………… 135
3.8.3 Linguistische (etymologisch-semantische) Aspekte des
Gleichgewichts …………………………………………………………………….. 139
3.8.4 Wesen und Bedeutung des Gleichgewichts und der Gegengewichte 140
3.8.5 Bipolarität zwischen den USA und der ehemaligen Sowjetunion 145
3.8.6 Militärstrategisches Gleichgewicht als spezieller Ausdruck der
Bipolarität ……………………………………………………………………………. 146
3.8.7 Gleichgewicht im Spannungsfeld von Stabilität und Veränderung 148
3.8.8 Supermacht, Hegemon und Imperium unter den Bedingungen des
Weltgleichgewichts ………………………………………………………………. 157
3.8.9 Multipolarität, mulipolares Gleichgewicht, Weltgleichgewicht ….. 164
3.8.10 Verhältnis von Gleichgewicht und kollektivem Sicherheitssystem 166
3.8.11 Ausblick Prognose ……………………………………………………………….. 172
3.9 Schlussfolgerungen ………………………………………………………………. 173
3.9.1 Zur Völkerrechtssoziologie (allgemein) ………………………………….. 173
3.9.2 Zur Interessenproblematik …………………………………………………….. 174
3.9.3 Zur Gleichgewichtsproblematik ……………………………………………… 178
3.10 Anmerkungen ………………………………………………………………………. 181
4. Völkerrechtsmethodologie als Bestandteil der Völkerrechtswissenschaft
und als Wissenschaftsgebiet in stau nascendi ……….. 206
4.1 Allgemeine Bedeutung der Völkerrechtsmethodologie ……………… 206
4.2 Allgemeine Aspekte der Völkerrechtsmethodologie …………………. 207
4.3 Verhältnis von Theorie, Philosophie und Methodologie ……………. 209
4.4 Spezielle Aspekte der Völkerrechtsmethodologie …………………….. 215
4.5 Methodologie der Völkerrechtsphilosophie ……………………………… 218
4.6 Methodologie der Völkerrechtssoziologie ……………………………….. 223
4.7 Schlussfolgerungen ………………………………………………………………. 230
4.8 Anmekungen ……………………………………………………………………….. 231
LITERATURVERZEICHNIS ………………………………………………………… 237
Abkürzungen
AdV Archiv des Völkerrechts
AFDI Annuaire Francais de Droit International
AJIL The American Journal of International Law
DZfPh Deutsche Zeitschrift für Philosophie
ÖZföRV Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht
RdC Recueil de Cours, Academie de Droit International, Den Haag
RGDIP Revue Général de Droit International Public
SJMP Sowjetskij jeshewodnik meschdunarodnowo prawa
SGiP Sowjetskoje gossudarstwo y prawo
ZaöRV Zeitdschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht